Johann Sebastian Bach, Brandenburgische Konzerte Nr. 5 und Nr. 2

Johann Sebastian Bach, Die Brandenburg Konzerte Nr. 2 und Nr. 5, Solisten und Orchester Pro Musica unter der Leitung von Hermann Rohden, « Die Grossen Musiker » (21), Bastei 1967.
 Le livret, 12 pages illustrées (en allemand).
Le livret, 12 pages illustrées (en allemand).
Die Broschüre, 12 illustrierte Seiten (auf Deutsch)
A : Johann Sebastian Bach, »Brandenburgisches Konzert Nr. 5 D-dur«, BWV (Bach-Werkverzeichnis) 1050, 1. Satz: Allegro, 2. Satz: Affettuoso, 3. Satz: Allegro.
Johann Sebastian Bach, »Brandenburgisches Konzert Nr. 2 F-dur«, BWV 1047, 1. Satz: Allegro, 2. Satz: Andante, 3. Satz: Allegro assai.
Zur Schallplatte
Johann Sebastian Bach, »Brandenburgisches Konzert Nr. 5 D-dur«, BWV (Bach-Werkverzeichnis) 1050.
1. Satz: Allegro, 2. Satz: Affettuoso, 3. Satz: Allegro.
Es spielen Wilhelm Titze, Flöte, Alois Moosmann,Violine, Paul Schlerf, Cembalo, und das Orchester Pro Musica unter der Leitung von Hermann Rohden.
(Super Majestic) ; Spieldauer: 23 Minuten
1721 vereinigte Bach in einer repräsentativen Reinschrift seine Sechs Brandenburgischen Konzerte. Markgraf Christian Ludwig von Brandenburg ist der Widmungsträger dieser Werksammlung. Aus diesem Grunde nannte man diese Konzerte auch nach Bachs Tod die Brandenburgischen. Sie alle gehen auf die Form der aus Italien überkommenen Musizierweise des Concerto zurück, einer der beliebtesten Gattungen barocker Orchestermusik.
Das 5. Brandenburgische Konzert ist das modernste der Reihe. Bach verwendet hier nicht wie noch im zweiten Konzert die ältere Blockflöte (Flauto dolce), sondern die moderne Querflöte (Flauto traverso). Auch setzt er innerhalb der Orchestermusik wohl als erster das Cembalo als Soloinstrument ein. Damit sind mit Flöte, Violine und Cembalo im Concertino alle drei wichtigen Instrumentengattungen vertreten. Dieses Concertino hebt sich sowohl in seiner Klangfarbe als auch in seiner musikalischen Funktion deutlich von dem nur dreistimmig gesetzten Streichorchester (Violinen, Violen und Bässe) ab. Bei der Generalbaßbegleitung ist auch das Cembalo beteiligt und damit zugleich Solo- und Begleitinstrument.
Mit den Sätzen in der Tempofolge schnell—langsam—schnell entspricht das 5. Brandenburgische Konzert äußerlich dem von Vivaldi entwickelten Typus. In der Gestaltung der einzelnen Sätze selbst geht Bach aber weit über dieses Vorbild hinaus. Das wird schon im ersten Satz (Allegro) offenbar. Während das Orchesterritornell in seiner mitreißenden Motorik nach italienischem Vorbild die thematische Führung der Violine betont, zeigt sich beim Einsatz der Solistengruppe Bachs ureigenste Schreibweise einer starken Verflechtung der Stimmen. So gehen in dem ganzen Satz die Partien der Solisten und des Orchesters ganz eigenständige Wege. Der stete Wechsel zwischen den musikalischen Gedanken des Concertinos und denjenigen des Tutti mündet in eine wachsende Vorherrschaft des Cembalos, dessen Figurationen schließlich in einer großen, virtuosen Solokadenz ihren Höhepunkt finden. Die Idee des damals noch nicht bekannten Klavierkonzertes, das später in Klassik und Romantik Triumphe feierte, ist hier bereits vorgezeichnet. Nach der Kadenz fällt das Orchester noch einmal mit dem markanten, den ganzen Teil beherrschenden Dreiklangsthema der Anfangstakte ein und beschließt damit den ersten Satz.
Im zweiten Satz vereinigen sich die drei Soloinstrumente ohne Orchesterbegleitung zu einem ausdrucksvollen, von großen melodischen Bögen bestimmten Affettuoso, einem lyrischen Satz, der ganz im Gegensatz zu dem betont motorischen Einleitungssatz steht und sich zu einem tief empfundenen Stück Bach’scher Ausdruckskunst gestaltet. Die Ubergangsstellung des Cembalos innerhalb der Ensemblemusik vom Begleit- 12 zum Soloinstrument zeigt sich auch in diesem Satz, denn einerseits spielt es hier wie in der Triosonate nur die ausharmonisierte Baßlinie zu den beiden Melodieinstrumenten, andererseits wird es aber auch in der Oberstimme zum gleichberechtigten Partner eines solistischen Kammerquartetts.
Auch in dem tänzerischen letzten Satz (Allegro) spielt das Cembalo eine ungewöhnlich selbständige Rolle, denn es sagt sich weitgehend von seinen beiden Solopartnern los, während Flöte und Solovioline in den von ihnen vorgetragenen Melodien enger aneinandergebunden bleiben.
Johann Sebastian Bach, »Brandenburgisches Konzert Nr. 2 F-dur«, BWV 1047.
1. Satz: Allegro, 2. Satz: Andante, 3. Satz: Allegro assai
Es spielen Albert Ziegler,Trompete, Otto Schimmer, Blockflöte, Richard Seitz, Oboe, Alois Moosmann, Violine, und das Orchester Pro Musica unter der Leitung von Hermann Rohden
(Super Majestic) - Spieldauer: 12 Minuten.
Das 2. Brandenburgische Konzert zählt zu den klangprächtigsten der ganzen Werkgruppe. Es ist in dieser Hinsicht allein dem ersten vergleichbar, das, ebenso wie das zweite, Blechbläser mit in die Besetzung einbezieht. Das Concertino bilden vier hohe Instrumente, deren Klangcharakter sehr unterschiedlich ist. Neben der schlanken Helligkeit der Bach-Trompete steht der zarte Klang einer Blockflöte, zu dem scharfen Oboenton gesellt sich das weiche Expressivo der Violine. In allen drei Sätzen findet Bach wiederum eine andere Art des Konzertierens. Nie legte er sich, wie später Händel in seinen Concerti grossi, auf einen Typ fest.
Im ersten Satz (Allegro) löst sich zunächst jedes Instrument einzeln aus dem prachtvollen Tuttiritornell heraus, um sich mit dem Solothema in seiner.besonderen Klanglichkeit vorzustellen. Erst dann schließen sich die vier Soloinstrumente zusammen und reißen förmlich die Führung des musikalischen Geschehens an sich, so daß in der zweiten Satzhälfte die Rolle des Orchesters allein auf die Begleitung der Solisten beschränkt bleibt. Sogar die ursprünglich nur dem Tutti vorbehaltene Thematik wird nun von dem Concertino übernommen und von ihm weiter verarbeitet. Damit verschwindet hier der für das Concerto grosso so typische Gegensatz zwischen Concertino und Tutti fast ganz. Das Gleichgewicht der beiden Partner wird vielmehr in einer für die damalige Zeit ganz kühnen Weise zugunsten des Concertinos auf gegeben.
Der Solotrompeter, dem in den Ecksätzen ein Höchstmaß an Virtuosität abverlangt wird, pausiert im langsamen Mittelsatz (Andante). Die übrigen Solisten entfalten in diesem Ruhepunkt des Konzertes ein eng verschlungenes Linienspiel voller Sanglichkeit und getragenem Ausdruck. Das geschieht vor dem Hintergrund eines in gleichen Notenwerten ruhig dahinfließenden Basses, der zur wechselnden Melodik der Oberstimmen wie in einer Passacaglia eine Phrase mehrmals wiederholt.
Der dritte Satz (Allegro assai) läßt den Trompeter wieder zu seinem vollen Recht kommen. Mit einem jubelnden Thema eröffnet er eine konzertante Fuge, in die nach und nach die übrigen Solopartner einstimmen. Das Orchester tritt hier schon vom Satzbeginn an ganz zurück und überläßt das Feld fast ausschließlich den Solisten, die nun ihre ganze Kunstfertigkeit ausspielen können. Der letzte Satz des 2. Brandenburgischen Konzertes ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Bach scheinbar mühelos strenge kontrapunktische Arbeit mit brillantem Schwung zu einem vollkommen gelösten und schwerelosen Gebilde zu formen vermag.
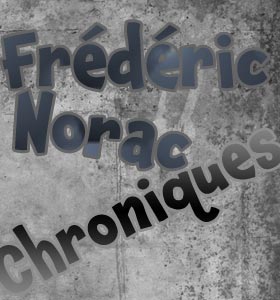
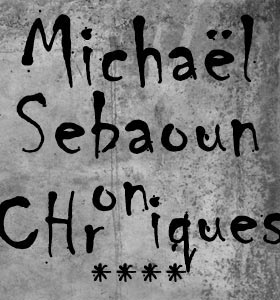
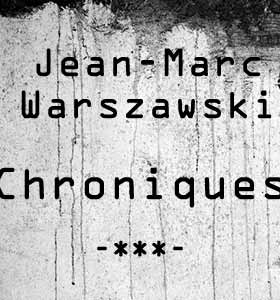
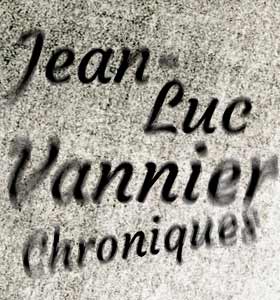
 À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
À propos - contact |
S'abonner au bulletin
| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.
Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.
ISNN 2269-9910.
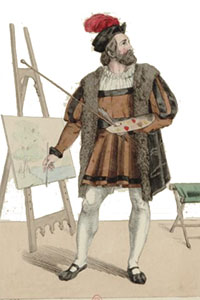
Mercredi 27 Novembre, 2024

